Im Allgemeinen Teil des BGB finden sich viele Probleme für Studierende im ersten Semester, die man vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Dazu gehört das Recht der beschränkt Geschäftsfähigen mit seinen zahlreichen Details, was ein beliebtes Thema in Prüfungsarbeiten darstellt.
Deshalb soll im Folgenden der Empfang einer Leistung durch einen Minderjährigen angesprochen werden.
Ein Minderjähriger, der also mindestens sieben und höchstens 17 Jahre alt ist, ist nur beschränkt geschäftsfähig, §§ 106, 2 BGB. Die Minderjährigkeit tritt gem. § 187 II 2 BGB mit Beginn des Geburtstages um 0 Uhr ein, an welchem das Kind sieben Jahre alt wird. Das Ende tritt am Beginn des 18. Geburtstages um 0 Uhr ein, § 187 II 2 BGB, wobei die konkrete Geburtsstunde unerheblich ist.Wenn jetzt der Minderjährige einen Anspruch gegen einen anderen auf eine Leistung hat, stellt sich die Frage, ob der Vertragspartner die Leistung mit Erfüllungswirkung an ihn erbringen kann und ob der Minderjährige etwa bei einer Übereignung der Sache das Eigentum erwerben kann.
Als Beispiel
möge der Fall dienen, dass der Minderjährige M vom erwachsenen K die Zahlung
von 50 € verlangen kann. Der K gibt dem
M sodann einen Geldschein über diesen Betrag.
Zunächst ist zu fragen, ob
der M an dem Geldschein das Eigentum erworben hat. Die neben der Übergabe erforderliche
Erklärung im Rahmen der dinglichen Einigung nach § 929 S. 1 BGB könnte für den
M lediglich rechtlich vorteilhaft sein, also bräuchte er keine Zustimmung
seines gesetzlichen Vertreters, § 107 BGB. Dann drängt sich aber sogleich die Frage auf, ob denn dieser Erwerb
nicht doch rechtlich nachteilig ist, denn durch die Übereignung könnte der
Anspruch aus dem schuldrechtlichen Geschäft nach § 362 I BGB durch Erfüllung
erloschen sein.
Um dieses Problem lösen zu können, werden verschiedene Ansichten in der Literatur vertreten.
So könnte man argumentieren, dass der Erwerb des Eigentums dann eben nicht lediglich rechtlich vorteilhaft sei und eine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich sei.
Demgegenüber lässt sich auch vertreten, dass die Übereignung lediglich rechtlich vorteilhaft sei und allein die Erfüllung des schuldrechtlichen Anspruchs nicht habe eintreten können.
Eine andere Auffassung will in solchen Fällen
von der Wirksamkeit der Übereignung und sogar der Erfüllung iSd. § 362 I BGB
ausgehen, denn man müsse das gesamte Geschäft betrachten, welches in
rechtlicher Hinsicht nur von Vorteil sei; für den Minderjährigen sei es besser,
die geschuldete Sache zu haben als bloß einen schuldrechtlichen Anspruch.
Ob man als Jurist/in in der Ausbildung all die verschiedenen Ansichten kennen muss, erscheint fraglich. Wichtig ist es aber, die herrschende Ansicht zu diesem Thema wiedergeben zu können. Nach ihr ist die Übereignung rechtlich vorteilhaft, und davon zu trennen sei die Frage der Erfüllung des schuldrechtlichen Anspruchs. Eine solche Erfüllung könne nicht eintreten, denn dem Minderjährigen fehle die Empfangszuständigkeit.
Im Beispiel hätte der M also das Eigentum an
dem Geldschein erworben, aber der Anspruch auf Zahlung wäre damit nicht
erloschen. Sollte der M den Schein auf
dem Weg nach Hause etwa verlieren oder das Geld verschwenden, könnte er erneut
Zahlung vom K verlangen. Wenn der K
somit sicher gehen will, dass auch eine Erfüllung eintritt, muss er entweder
auf eine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Übereignung hinwirken oder
die Sache an den gesetzlichen Vertreter übereignen.
Natürlich hätte der K dann
im Fall des Verlusts des Scheins durch den M ohne eine Zustimmung einen
Bereicherungsanspruch gegen Letzteren, weshalb er eine Aufrechnung erklären und
somit den Anspruch des M auf Zahlung zu Fall bringen könnte. Allerdings würde dieser Gegenanspruch an dem
Wegfall der Bereicherung seitens des M scheitern, § 818 III BGB, wobei selbstverständlich
eine etwaige Bösgläubigkeit des M nach §§ 818 IV, 819 I BGB zu prüfen wäre.
Hier sind weitere Artikel zum Vertragsschluss zu finden
Die
falsche Preisauszeichnung im Selbstbedienungsladen
Vertragsschluss
an der Tankstelle
Das
Schweigen im Rechtsverkehr und das kaufmännische Bestätigungsschreiben
Vertragsschluss
beim Bäcker/Metzger im Supermarkt
Wissenszurechnung
nach § 166 BGB

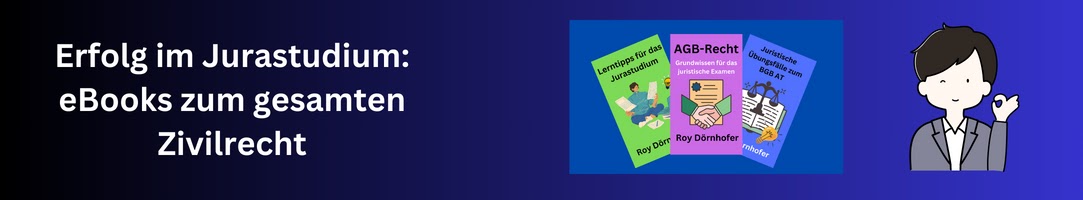


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen