Hier sind weitere Artikel zum Vertragsschluss zu finden
Die
falsche Preisauszeichnung im Selbstbedienungsladen
Vertragsschluss
an der Tankstelle
Das
Schweigen im Rechtsverkehr und das kaufmännische Bestätigungsschreiben
Vertragsschluss
beim Bäcker/Metzger im Supermarkt
Ausgangssituation
1. Rücktrittsregelungen
Als Folge des
Rücktritts sind die jeweils empfangenen Leistungen Zug um Zug zurück zu gewähren,
§ 346 I BGB. Das ursprüngliche
Schuldverhältnis wird also in ein Rückabwicklungsverhältnis auf einer
vertraglichen Grundlage umgeändert.
Deshalb muss der Verkäufer den Kaufpreis zurückzahlen, während der
Käufer die Kaufsache zurück zu gewähren hat.
Nun stellt sich allerdings die Frage, ob der Käufer die Kosten für die ursprüngliche Hinsendung an ihn erstattet bekommt und ob er etwa die Rücksendekosten tragen muss.
Hier lohnt sich zunächst ein Blick auf Verbraucherverträge, bei denen vom Grundsatz her Folgendes gilt: Bei Verträgen ab dem 13.6.2014 muss der Käufer bei dem verbraucherschützenden Widerruf die Rücksendekosten selbst tragen, sofern er entsprechend belehrt wurde, § 357 VI BGB (nunmehr § 357 V 1 BGB). Demgegenüber muss der Verkäufer die Hinsendekosten in diesem Fall erstatten, § 357 II 1 BGB.
Die Situation beim gesetzlichen Rücktrittsrecht ist jedoch eine andere. Hier sieht das Gesetz keine Erstattung der Hin- oder Rücksendekosten nach §§ 346 ff. BGB vor.
Mit der Schuldrechtsmodernisierung wurde auch die Vorschrift des § 467 S. 2 BGB a.F. abgeschafft, nach welcher die Vertragskosten vom Verkäufer zu erstatten waren.
Auch stellen die Regelungen der §§ 346 ff. BGB keine verbraucherschützenden Vorschriften dar. Man kann deshalb die Widerrufsregelungen nicht zur Auslegung der Rücktrittsvorschriften heranziehen.
Ein Ersatzanspruch für nicht notwendige Verwendungen gem. § 347 II 2 BGB scheitert regelmäßig an einer Bereicherung des Verkäufers. Die Erstattung von Vertragskosten kann nunmehr nur noch im Rahmen eines Schadens- oder Aufwendungsersatzanspruchs erfolgen (BGH NJW 2009, 66, Rn. 14).
Eine Lösung muss somit außerhalb des
Rücktrittsrechts gefunden werden.
2. Aufwendungs-/Schadensersatz
So könnte sich der Ersatz der Kosten für die Hinsendung aus einem Aufwendungsersatz nach §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 284 BGB ergeben (Reinicke/Tiedtke, Kaufrecht, 8. Auflage, 2009, Rn. 246).
Die Vorschrift des § 284 BGB ist nach
herrschender Ansicht auch neben einem Rücktritt anwendbar, denn wenn schon ein
Schadensersatz nebenher gem. § 325 BGB möglich ist, muss das auch für den
Aufwendungsersatz gelten, der an die Stelle des Schadensersatzes tritt. Dann allerdings müsste der Verkäufer auch die
mangelhafte Lieferung der Kaufsache zu vertreten haben, was oft nicht der Fall
sein wird.
Hinsichtlich der Rücksendekosten kann man nach meinem
Verständnis nicht auf die Vorschrift des § 284 BGB abstellen. So allerdings wohl das AG Düsseldorf, Urteil vom 12.06.2006 - 56 C 4276/06:
„Dem
Kläger steht darüber hinaus gegen den Beklagten ein Anspruch auf Zahlung der
aufgewendeten Versandkosten i.H.v. insgesamt 19,00 EUR (12,00 EUR Hinsendung +
7,00 EUR Rücksendung) gemäß §§ 434 Abs. 1, 437 Nr. 3, 440, 280 Abs. 1, 284 BGB
zu. Der Verkauf von Lampen, die nicht der Verkaufsbeschreibung entsprechen,
stellt eine Pflichtverletzung i.S.v. § 280 Abs. 1 BGB dar. Das Verschulden des
Beklagten an der fehlerhaften Angabe des Herstellungszeitraums wird im
Anwendungsbereich von §§ 280, 284 BGB vermutet. Eine hinreichende Exkulpation
nebst tauglichem Beweisantritt ist nicht erfolgt.“
Das erscheint aus dogmatischer Sicht problematisch. Zum einen verlangt die Vorschrift das Vorliegen der Voraussetzungen eines Schadensersatzes statt der Leistung, was mit der vom Gericht zitierten Regelung des § 280 I BGB gerade nicht der Fall ist.
Zum anderen wird man hier kaum
annehmen können, dass der Käufer die Rücksendekosten (anders als die
Hinsendekosten) im Vertrauen auf die Erlangung der vertragsgemäßen Leistung aufwendet,
sodass die genannte Vorschrift nicht zur Anwendung kommen kann.
Auch ein Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo scheint mir nicht gegeben zu sein. Der Verweis auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH NJW 1985, 2697, 2698) wird nach der Schuldrechtsmodernisierung kaum noch überzeugen. Denn nunmehr ist beim Schadensersatz abzugrenzen, ob ein solcher statt oder neben der Leistung verlangt wird. Die Rücksendekosten wären aber bei rechtzeitiger Erfüllung nicht angefallen, sodass es sich insoweit um einen Schadensersatz statt der Leistung handelt, der nicht mit der culpa in contrahendo ersetzt werden kann.
Wenn man dann einen Schadensersatz statt der Leistung annehmen will, würde dieser jedoch nur möglich sein, wenn der Käufer nicht zugleich nach §§ 280 I, III, 284 BGB vorgeht.
Ebenso bedarf es eines
Verschuldens des Verkäufers, das zwar vermutet wird, aber doch widerlegt werden
kann, zumal den Verkäufer keine Prüfungspflicht hinsichtlich der verkauften
Sache trifft. Auch ein Händler muss die
neue Ware nicht untersuchen, sofern nicht Mängel offen ersichtlich sind (Lorenz
NJW 2002, 2497). Vielmehr darf er darauf
vertrauen, dass die neue Ware nicht mit Fehlern behaftet ist (OLG Köln ZGS 2006, 77).
Hier sind weitere Artikel
zum Schadensrecht zu finden
Mitverschulden
bei der Haftungsausfüllung, § 254 II 1 BGB
Dieselskandal
und Schadensrecht
Schadensminderungspflicht
und Kaskoversicherung
Schadensersatz
bei Verletzung des Anwartschaftsrechts
Ehrverletzenden
Äußerungen und zivilrechtliche Folgen
Schadensersatz
wegen Verbrühung mit heißem Tee?
3. Holschuld des Verkäufers
Eine bessere Lösung für den Käufer könnte jedenfalls hinsichtlich der Rücksendekosten darin liegen, dass man darauf abstellt, was er denn nach dem Rücktritt schuldet. Er muss die Sache zurückgeben.
Nach herrschender Ansicht muss der Verkäufer die Ware dann dort abholen, wo sie sich vertragsgemäß befindet (MüKo-Krüger, BGB, 6. Auflage, 2012, § 269 Rn. 41). Dieser Ort stellt den Leistungsort für den Rücktritt dar (BGHZ 87, 104, 109), was auch für das gesetzliche Rücktrittsrecht gilt (BGH WM 1974, 1073).
Also ist der Käufer gar nicht verpflichtet,
die Kaufsache an den Verkäufer zu übersenden und muss insofern die Kosten auch
nicht verauslagen und dann im Wege des Schadensersatzes zurückverlangen.
Wenn also der
Verkäufer die Sache beim Käufer abholen muss, reicht es aus, dass Letzterer die
Sache zur Abholung anbietet und bereit hält und keine Versendung auf seine
Kosten durchführt. Nachdem es sich
insoweit um eine Holschuld des Verkäufers nach § 269 I BGB handelt, muss dieser
sich auf den Weg machen oder aber dem Käufer die Kosten für eine Versendung
vorschießen. Bei dieser Lösung kommt es
mangels Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs auch auf ein Verschulden
des Verkäufers hinsichtlich der mangelhaften Lieferung nicht an.
Weiterführende Literatur
In meinem eBook* „Juristische Übungsfälle
zum Kaufrecht“ habe ich eine ausführliche Fallsammlung zu kaufrechtlichen
Problemen erstellt. Wer Interesse hat, kann das Buch hier finden:
Juristische Übungsfälle zum Kaufrecht
Hier sind weitere Artikel zum Kaufrecht zu finden
Die
Nacherfüllung beim Kaufvertrag
Die
Feinheiten des § 442 I 1 BGB
Der
Verschleiß als Mangel der Kaufsache
Frist
zur Nacherfüllung und zweite Gelegenheit zur Nachbesserung
Die
Eintrittskarte im Vorverkauf
Umtausch,
Gewährleistungsrecht, Garantie – Was ist der Unterschied?
Der
falsch gelieferte Artikel (aliud) beim Kaufvertrag im Internet – Wer hat welche
Rechte?
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

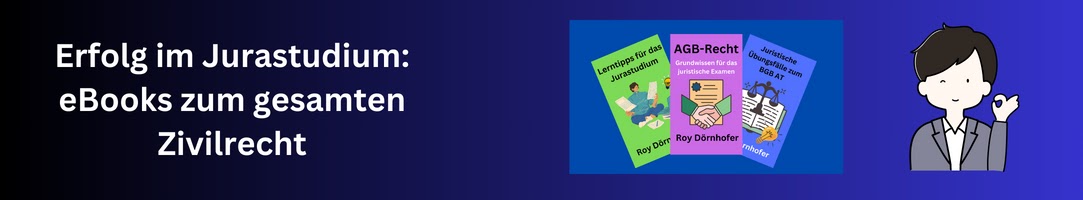



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen