Im juristischen Studium lernt man recht frühzeitig das Recht der gesetzlichen Schuldverhältnisse kennen. Dort nimmt die Geschäftsführung ohne Auftrag einen bedeutenden Platz ein.
Dieser Teilbereich enthält eine Vielzahl an Problemen, die sich immer wieder in Klausuren und Hausarbeiten finden. Insofern sollte man solide Kenntnisse der Materie haben.
Im Folgenden soll ein solches
Problem kurz dargestellt werden. Es handelt sich um die Frage, ob ein Schaden als Aufwendung bei der
Berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag
Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag führt dazu, dass der Geschäftsführer nach §§ 677, 683, 670 BGB Ersatz seiner Aufwendungen verlangen kann. Zur Tatbestandsseite hat der Bundesgerichtshof in einer neuen Entscheidung klargestellt, dass eine Abgrenzung zwischen einer Geschäftsführung und einer außerrechtlichen Gefälligkeit erfolgen muss, bevor man überhaupt zu den Rechtsfolgen gelangt. Diese Abgrenzung wird sodann mit denselben Argumenten durchgeführt, wie dies im Rahmen einer bloßen Gefälligkeit des täglichen Lebens oder einer vertraglichen Bindung erfolgt, nämlich anhand des Rechtsbindungswillens der Parteien (BGH, Urteil vom 23. Juli 2015 - III ZR 346/14). Das soll hier aber nicht weiter interessieren, sondern ich will mich auf ein Problem auf der Rechtsfolgenseite beschränken.
Schaden als Aufwendung?
Der Geschäftsführer kann also Ersatz seiner Aufwendungen fordern, die er für erforderlich halten durfte. Dies war schon nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts vom Standpunkt eines nach verständigem Ermessen Handelnden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Aufwendungen werden dabei allgemein als freiwillige Vermögensopfer definiert. Wenn nun aber der Geschäftsführer bei der Durchführung des Geschäfts einen Schaden erleidet, dann stellt dies eine unfreiwillige Vermögenseinbuße dar und wäre an sich nach dem Wortlaut des Gesetzes vom Ersatzanspruch nicht umfasst.
Eine Mindermeinung will es demnach wegen des Wortlauts des Gesetzes auch bei diesem Ergebnis belassen.
Dass dieses Ergebnis nicht gerecht sein kann, liegt auf der Hand. Deshalb besteht Einigkeit, dass auch bestimmte Schäden ersetzt werden sollen.
Nach einer Auffassung in der Literatur werde der Schaden aus dem allgemeinen Rechtsgedanken des § 110 I HGB a.F. ersetzt, da der Anspruch auf einer Risikozurechnung bei schadensgeneigter Tätigkeit in fremdem Interesse beruhe.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der herrschenden
Meinung in der Literatur könne der Begriff der Aufwendung demgegenüber
ausgedehnt werden und § 670 BGB analog angewendet werden. Ein solcher Aufwendungsersatzanspruch setzte
voraus, dass sich das Opfer aus der mit der Geschäftsführung verbundenen Gefahr
ergeben habe, wobei es sich - in Parallele zu den Fällen des
Schadensersatzanspruchs aus dem Gesichtspunkt der Herausforderung - um eine
tätigkeitsspezifische gesteigerte Gefahr handeln müsse (BGH NJW 1993, 2234,
unter II 2). Es muss an dieser Stelle
also eine Abgrenzung zum allgemeinen Lebensrisiko erfolgen, für welches der
Geschäftsführer keinen Ersatz erhielte.
Hier sind weitere Artikel
zum Schadensrecht zu finden
Mitverschulden
bei der Haftungsausfüllung, § 254 II 1 BGB
Dieselskandal
und Schadensrecht
Schadensminderungspflicht
und Kaskoversicherung
Schadensersatz
bei Verletzung des Anwartschaftsrechts
Ehrverletzenden
Äußerungen und zivilrechtliche Folgen
Schadensersatz wegen Verbrühung mit heißem Tee?
Ersatz für Nichtvermögensschaden?
Falls man zu dem Ergebnis kommt, dass ein Ersatzanspruch besteht, stellt sich gelegentlich die Frage, ob der Geschäftsführer etwa auch einen Ersatz für seinen Nichtvermögensschaden gem. § 253 II BGB (Schmerzensgeld) beanspruchen kann. Das hatte der Bundesgerichtshof vor vielen Jahren noch verneint (BGHZ 52, 115).
Nunmehr wird man hier seit der Änderung des Gesetzes und der Einfügung des § 253 II BGB dennoch ein Schmerzensgeld gem. § 670 BGB analog zusprechen können, obgleich es sich bei dem Anspruch nicht um einen solchen auf Schadensersatz handelt (Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse, 10. Auflage, 2020, § 5 Rn. 39; Palandt-Sprau, BGB, 71. Auflage, 2012, § 670 Rn. 13; Staacke, Gesetzliche Schuldverhältnisse, 2014, § 16 Rn. 15).
Natürlich finden sich hier auch ablehnende Stimmen in der Literatur (MüKo/Schäfer, BGB, 8. Auflage, 2020, § 683 Rn. 39).

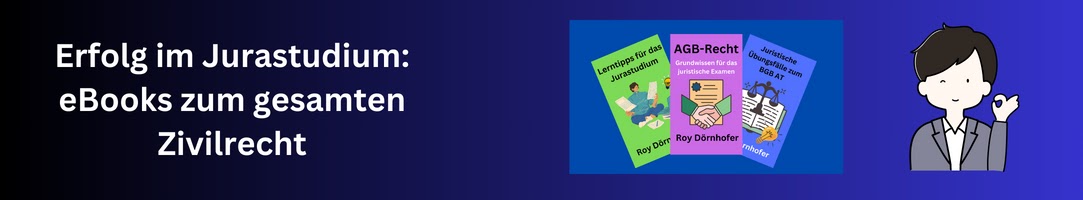



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen